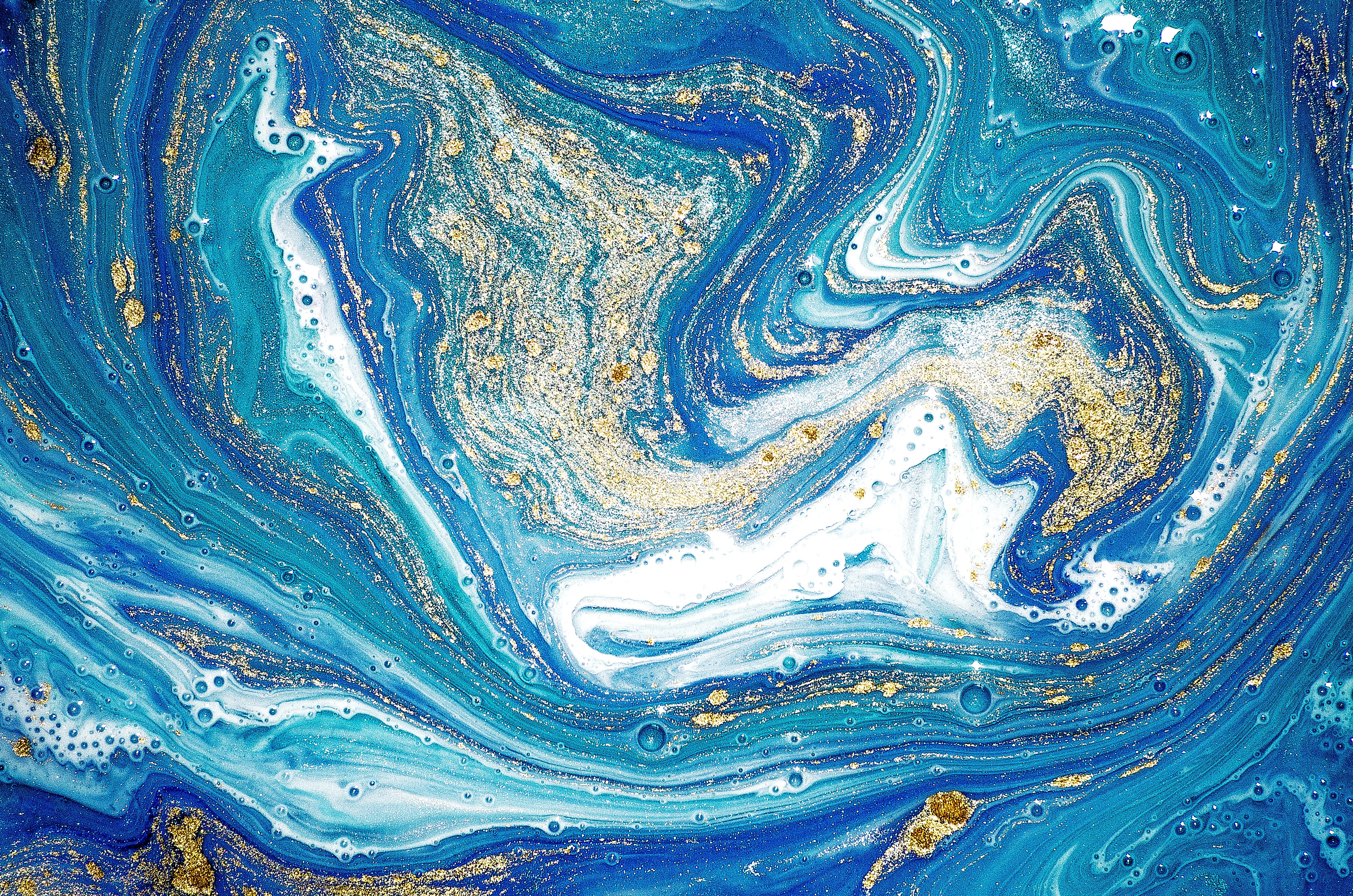Die juristische Aufarbeitung des Skandals um die vom französischen Hersteller von fehlerhaften Brustimplantaten Poly Implant Prothèse (PIP) hat neben den europäischen auch bereits eine Vielzahl mitgliedstaatlicher Gerichte beschäftigt. Der EuGH gab sich in zwei Entscheidungen reserviert, indem er den nationalen Rechtsordnungen weder eine aus der RL 93/42/EWG folgende Pflicht auferlegte, für Verstöße gegen die darin festgelegten Prüfpflichten Schadensersatzansprüche nach nationalem Recht einzuräumen (EuGH, Urteil v. 16.2.2017 – C-219/15 (Schmitt/TÜV Rheinland)), noch in der territorialen Beschränkung des Versicherungsschutzes des französischen Haftpflichtversicherers auf in Frankreich ansässige Geschädigte einen Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot aus Art. 18 AEUV erblickte (EuGH Urteil v. 11. Juni 2020 – C-581/18 (TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Allianz IARD SA)). Geschädigten außerhalb Frankreichs blieb somit der Zugriff auf die Alianz verwehrt, mit der Folge, dass aufgrund der bereits 2010 eingetretenen Insolvenz des Herstellers nur eine Inanspruchnahme des TÜV Rheinland wegen Verletzung von drittschützenden Prüfungspflichten in Betracht kam. Für dem deutschen Recht unterliegende Klagen verneinte der BGH bereits 2017 Ansprüche sowohl aus Vertrag Schutzwirkung zu Gunsten Dritter als auch wegen Verletzung von Schutzpflichtgesetzen (BGH NJW 2017, 2617) gegen die als sogenannte „benannte Stelle“ als Adressatin einer solchen Pflicht in Betracht kommende Gesellschaft TÜV Rheinland LGA Products GmbH. Die französische Cour de Cassation bejahte hingegen in einer Entscheidung vom 10.10.2018 (N° de pourvoi : 15-28.531) eine solche deliktische Pflichtverletzung aufgrund des Vorliegens von Indizien für Unregelmäßigkeiten bei PIP, und die Cour d‘ Apell Paris gab im Jahre 2021 der an sie zurückverwiesenen Klage von Geschädigten aus Delikt statt.
Auf dieser Anspruchsgrundlage basierte auch eine vor spanischen Gerichten erhobene Klage, welche kurioserweise jedoch nicht gegen die als sogenannte „benannte Stelle“ als alleinige Schuldnerin in Betracht kommende Gesellschaft TÜV Rheinland LGA Products GmbH, sondern ausdrücklich gegen die gesamte „TÜV-Gruppe“ erhoben wurde, „unabhängig davon, unter welchen Bezeichnung diese jeweils am Markt auftrete“. Nachdem das Gericht erster Instanz in Valencia einen solchen auf der Prämisse einer konzernrechtlichen Globalhaftung geltend gemachten Anspruch ablehnte, und der Oberste Gerichtshof in einer anderen Entscheidung bereits die Zustellung (nur) an die spanische Schwestergesellschaft der TÜV Rheinland LGA Products GmbH mangels einer Vertretung der einzelnen Konzerngesellschaften untereinander für unwirksam ansah, hielt das OLG Valencia die letztlich an die Muttergesellschaft TÜV Rheinland AG als Beklagte zugestellte Klage hingegen für begründet. Die nach der RL 93/42/EWG bestehenden drittschützenden Prüfpflichten träfen die gesamte Unternehmensgruppe, die sich nicht auf die juristische Selbständigkeit ihrer einzelnen Konzerngesellschaften zurückziehen könne.
Eine solche dogmatisch in keinster Weise näher begründete Globalhaftung mag zwar sozio-psychologisch möglicherweise durch die als unbefriedigend empfundene restriktive Haltung des EuGH, durch neue Tendenzen in der Rechtsprechung zur sog. CSR (sh. die Fälle „Lungowe v Vedanta Resources“; „Okpabi v Shell“ und „Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc.“) oder die zunehmende Politisierung der spanischen Gerichte motiviert sein. In der hier besprochenen Entscheidung nº 35/2019 vom 24.01.2022 kassiert der Oberste Gerichtshof die Entscheidung der Vorinstanz glücklicherweise nun in der Revision jedoch zu Recht. Denn das spanische Recht kenn zwar grundsätzlich mit der Durchgriffshaftung (doctrina del levantamiento del velo) die Möglichkeit eines Haftungsdurchgriffs für verschiedene Fallgruppen, die ständige Rechtsprechung betone jedoch das gesellschaftsrechtliche Trennungsprinzip, so dass daher alleine aus der Konzernzugehörigkeit kein allgemeiner Haftungsdurchgriff abgeleitet werden könne. Auch der gemeinsame Firmenkern „TÜV Rheinland“ genüge dafür nicht. Gleichwohl hält auch der Oberste Gerichtshof an dem schwammigen, in der Praxis zu hoher Rechtsunsicherheit führenden Instrument de levantamiento del velo und insbesondere dessen nicht abschließenden Charakter (numerus apertus) fest.
Bedenklich erscheint uns dabei erneut, dass in allen Instanzen sämtliche Erwägungen zur Durchgriffshaftung alleine das materielle Recht behandeln, schwierige kollisionsrechtliche und unionsrechtliche Fragen zum anwendbaren Recht hingegen völlig ignorieren. So hätte man die Klage im Anlassfall bereits deswegen abweisen können, weil nach ghM auch im spanischen Recht die Durchgriffshaftung außerhalb von hier nicht gegebenen kollisionsrechtlich umstrittenen Vertrauenshaftungstatbeständen einer gesellschaftsrechtlichen Qualifikation unterliegt und somit richtigerweise nur nach deutschem Recht hätte beurteilt werden dürfen. Eine ganz andere Frage ist hingegen gerade im Hinblick auf die aktuelle CSR-Diskussion, ob die Konzernmuttergesellschaft eine möglicherweise nach dem Deliktsstatut der Rom II-VO anzuknüpfende konzernweite Überwachungs- Verkehrssicherungs- oder Verrichtungsgehilfenhaftung für ihre Tochtergesellschaften treffen kann, und bejahendenfalls, ob diese dann spanischem Recht als dem Ort des Erfolgseintritts unterliegt oder eine konzernrechtliche Durchgriffshaftung aufgrund der Ausweichklausel gem. Art. 4 Abs. 3 Rom-II-VO deutschem Recht aufgrund der durch die gesellschaftsrechtlichen Sonderbeziehung engeren Beziehung zwischen Tochter- und Muttergesellschaft unterliegt.
Da auch das deutsche Recht eine solche globale Konzernhaftung ablehnt, hätte dies zwar im Anlassfall zu keinem anderen Ergebnis geführt. Bestärkt durch die Rechtsprechung der französischen Gerichte hätte die Klägerin hingegen dann, wenn ihr Rechtsanwalt die „richtige Gesellschaft“ TÜV Rheinland LGA Products GmbH verklagt hätte, mit einer solchen direkt gegen die Tochtergesellschaft erhobenen und auf Delikt gestützten Klage vorbehaltlich einer evtl. bereits eingetretenen Verjährung durchaus mehr Aussicht auf Erfolg gehabt, anstatt an den restriktiven Voraussetzungen des gesellschaftsrechtlichen Instruments des levantamiento del velo mit einer wegen der gegebenen Solvenz der Tochtergesellschaft aus wirtschaftlichen Gründen im Übrigen sinnlosen Klage gegen die Muttergesellschaft TÜV Rheinland AG aus Durchgriffshaftung zu scheitern. Daran lässt sich leicht erkennen, dass ein unreflektiertes anwaltliches Vorbringen in solchen grenzüberschreitenden Konzernhaftungsfällen ein dem Grunde nach ggfs. gegebenen Anspruch vereiteln und so auch zur Haftung des anwaltlichen Beraters führen kann, wenn bei der Auswahl der haftenden Konzerngesellschaft nicht ein ebenso hoher Aufwand wie bei der Prüfung und Substanziierung der jeweiligen Anspruchsgrundlage betrieben wird. Spezialisierte Beratung im Internationalen Gesellschaftsrechts- und Konzernrecht sowie IPR tut daher Not und zahlt sich aus, ganz zu schweigen von den diffizilen zuständigkeitsrechtlichen Fragen!
Florian Deck, 18.2.2022