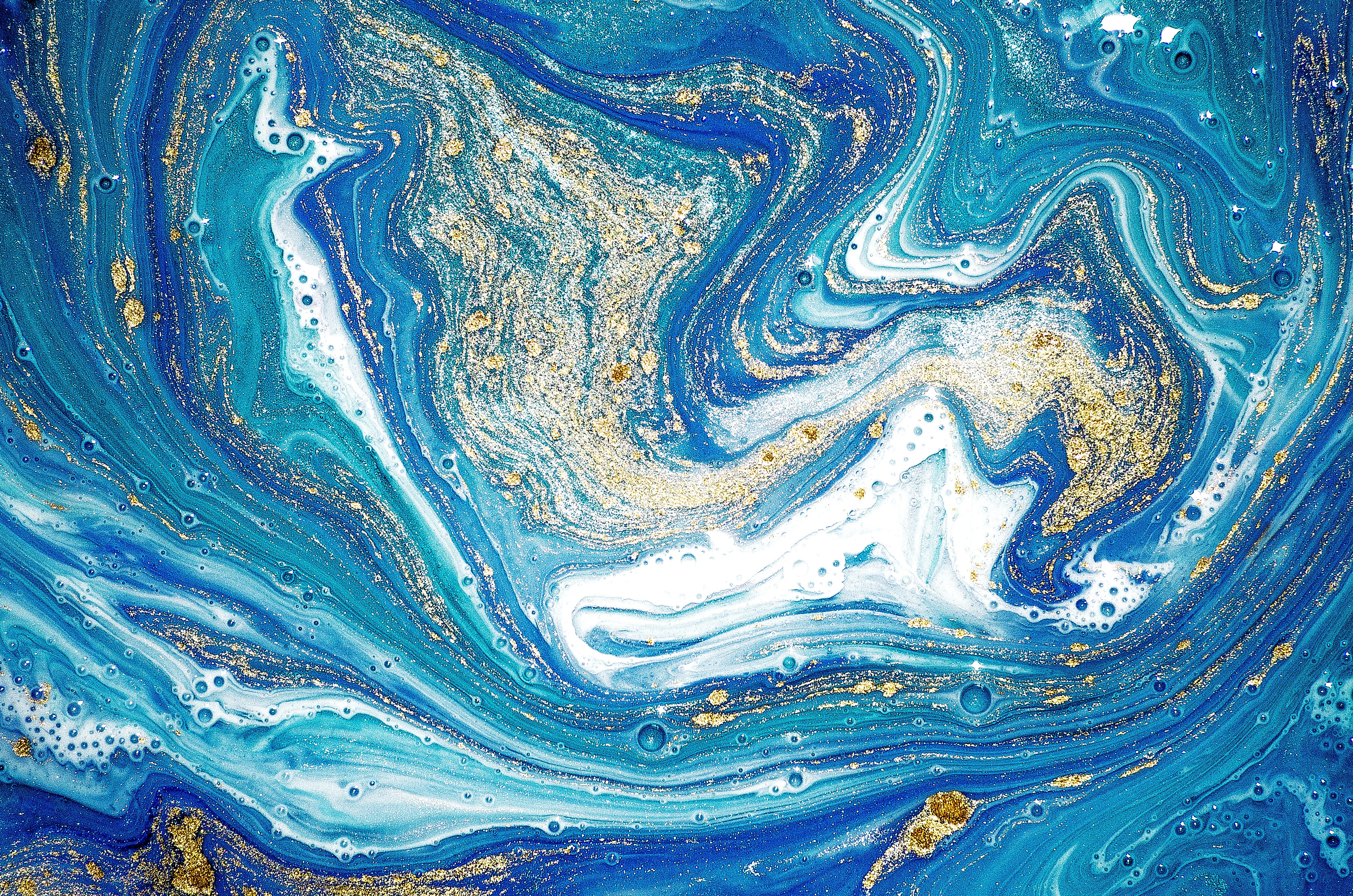Die große Kammer des EuGH hat in der oben genannten Entscheidung vom 18.10. einer Klage von IG Metall und Ver.di gegen die Beteiligungsvereinbarung der SAP SE stattgegeben. Diese sah eine Regelung für den Fall eines auf insgesamt 12 Mitglieder verkleinerten der paritätisch Mitbestimmung unterliegenden Aufsichtsrats vor, wobei von den insgesamt den Arbeitnehmervertretern zustehenden 6 Sitzen 4 Sitze den in Deutschland beschäftigten Arbeitnehmern zugeteilt und den deutschen Gewerkschaften für mehrere dieser 4 deutsch Sitze Vorschlagsrechte eingeräumt wurden. Diese wurde jedoch nicht durch einen eigenen Wahlgang abgesichert, so wie dies vor Umwandlung der Gesellschaft in eine SE nach der Bestimmung des § 16 Abs. 2 Satz 1 MitbestG noch der Fall war. Die Beteiligungsvereinbarung schloss somit nicht die Möglichkeit aus, dass bei der Wahl der Arbeitnehmervertreter statt der vorgeschlagenen Gewerkschaftskandidaten andere nicht gewerkschaftsangehörige Arbeitnehmervertreter gewählt werden konnten.
Der EuGH sah darin nun einen Verstoß gegen Art. 4 Abs. 4 der Richtlinie 2001/86/EG („Beteiligungs-RL“). Dieser bestimmt für den hier einschlägigen Sonderfall einer SE-Gründung durch Umwandlung, dass die Beteiligungsvereinbarung in Bezug auf alle Komponenten der Mitbestimmung zumindest das gleiche Ausmaß wie nach dem vorher anwendbaren nationalen Recht gewährleisten muss (Vorher-Nachher-Prinzip). Der EuGH schloss sich der bereits vom vorlegenden BAG vertretenen Auffassung an, dieses Verschlechterungsverbot früher zwar nicht zu einer absoluten Zementierung der Zusammensetzung und der inneren Ordnung des Aufsichtsrats wie unter dem MitbestG, nach dem nationalen Recht prägende Elemente der Mitbestimmung (wozu nicht nur das gewerkschaftliche Vorschlagsrecht, sondern auch das getrennte Wahlverfahren gehörten) seien jedoch einer abweichenden Vereinbarung entzogen. Er erteilte somit der bislang herrschenden Lehre eine Absage, die lediglich den proportionalen Anteil der Arbeitnehmervertreter als von Art. 4 Abs. 4 Beteiligungs-RL umfasst ansah.
Zugleich unterstreicht der EuGH ausdrücklich, dass solche nach nationalem Mitbestimmungsrecht zwingenden Komponenten auch auf sämtliche anderen innerhalb der EU und des EWR in Tochtergesellschaften oder Betrieben des Unternehmens vertretene Gewerkschaften zu erstrecken sei. Dadurch wird nicht nur der Sonderweg der Beteiligung von externen, nicht im Unternehmen beschäftigten, Gewerkschaftsvertretern des deutschen Rechts als vereinbarungsfest gebilligt, sondern es folgt über das Einfallstor des Art. 4 Abs. 4 der Beteiligungs-RL zugleich ein zwingender Export dieses faktischen Benennungsrechts auf alle übrigen EU/EWR-Beschäftigungsstaaten, dessen Vereinbarkeit mit der Richtlinie in sonstigen Fällen (also gesetzliche Auffanglösung oder Beteiligungsvereinbarung in anderen Fällen als jenen der Umwandlung) hoch umstritten und schwerlich mit anderen Bestimmungen der Beteiligungs-RL in Einklang zu bringen ist, da letztere grundsätzlich nur Arbeitnehmern, nicht jedoch Externen Mitbestimmungsrechte einräumt. Durch die obiter erfolgte mehrfache Betonung der zwingenden Internationalisierung der Mitbestimmung auch in den Fällen der Beteiligungsvereinbarung ist zudem fraglich, ob eine von der gesetzlichen Auffanglösung abweichende Verteilung der Sitz auf die Mitgliedstaaten privatautonome überhaupt noch möglich ist. Die weite Auslegung von Art. 4 Abs. 4 Beteiligungs-RL lässt es gar für möglich erscheinen, dass die Rechtsprechung künftig entgegen der bisherigen Praxis auch andere Elemente wie etwa die Größe des Aufsichtsrats als von der Veränderungssperre umfasst ansieht.
Ob die Beteiligungsvereinbarung im Falle der SE aufgrund der damit verbundenen Rechtsunsicherheit sowie der in vielerlei Hinsicht kastrierten Parteiautonomie in der Praxis überhaupt noch eine Zukunft hat, erscheint daher fraglich. Gleiches gilt nach Ansicht des Generalanwalts übrigens für den grenzüberschreitenden Formwechsel und die Spaltung nationaler Rechtsformen, für die die GesRRL ebenfalls auf Art. 4 Abs. 4 Beteiligungs-RL verweist. Bestehen also Gestaltungsalternativen? Ob in Bezug auf die durch Formwechsel gegründete SE ein Rückgriff auf die gesetzliche Auffanglösung genutzt werden kann, um der Eindringen externer Gewerkschaftsmitglieder zu verhindern, ist fraglich. Zwar spricht dafür, dass das Sekundärrecht (Beteiligungs-RL) anders als das deutsche MitbestG die Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat auf Arbeitnehmer des betroffenen Konzerns begrenzt. Sicher ist dies jedoch nicht, da die Beteiligungs-RL bei der SE auch für die Auffanglösung eine Perpetuierung aller Komponenten des nationalen Mitbestimmungsregimes anordnet. Und die anderen nicht den strengen Anforderungen des Art. 4 Abs. 4 Beteiligungs-RL unterliegenden Modalitäten der SE-Gründung kommen für nach dem nationalen Recht eines Mitgliedstaates bestehenden Aktiengesellschaften oft nicht in Frage, so dass sie meist keine geeignete Alternative darstellen, um ein bestehendes Mitbestimmungsregime nach dem MitbestG zu flexibilisieren.
Der sicherste Weg scheint daher in einem Ausweichen auf die grenzüberschreitende Verschmelzung nationaler Rechtsformen und somit in einer gänzlich „Flucht aus der SE“ zu liegen: denn für grenzüberschreitende Verschmelzungen verweist die GesRRL nämlich für die Beteiligungsvereinbarung ausdrücklich nicht auf Art. 4 Abs. 4 Beteiligungs-RL. In dieser Variante der grenzüberschreitenden Verschmelzung bietet gerade im hier einschlägigen und in der Praxis häufig anzutreffenden Fall eines Doppel-6er Aufsichtsrats auch die gesetzliche Auffanglösung ein effektives Mittel zumindest zur Begrenzung der faktischen Benennungsrechte der deutschen Gewerkschaften. Denn den deutschen Arbeitnehmervertretern stehen wegen der zwingenden Internationalisierung der Arbeitnehmerbank im Aufsichtsrat in aller Regel nie mehr als 5 Sitze zu, wobei das deutsche MgVG nur für jeden dritten Sitz ein gewerkschaftliches Vorschlagsrecht vorsieht. Selbst wenn also das für den 6. Sitz anwendbare ausländische Recht ebenfalls ein gewerkschaftliches Vorschlagsrecht vorsieht (was zudem nicht stets der Fall ist), beschränkt sich dieses in vielen Mitgliedstaaten nur auf im Unternehmen beschäftigte Gewerkschaftsmitglieder, so etwa in Österreich (sh. ArbVG) oder auch Spanien (sh. LITSE). Trauriges Fazit: the (German) SE is dead, long live the cross-border merger!
Florian Deck, 21.10.2022