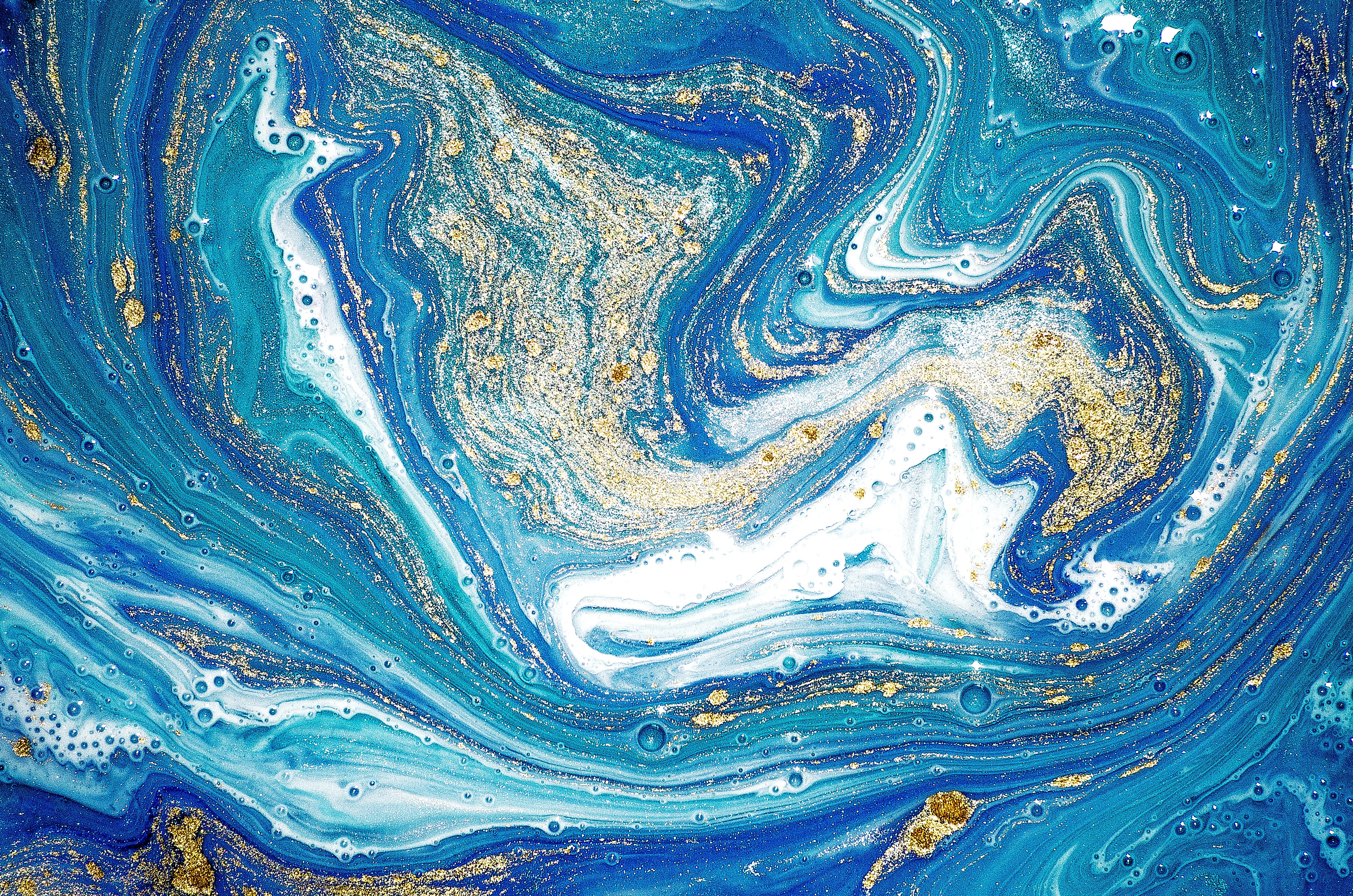In einer Entscheidung vom 16. September 2020 hat der österreichische OGH mehrere umstrittene Rechtsfragen zu den Grenzen der Zulässigkeit satzungsmäßiger Abfindungsbeschränkungen im Zusammenhang mit Aufgriffsrechten anlässlich der Insolvenz eines ihrer Gesellschafter geklärt. In der Praxis besteht gerade bei personalistisch verfassten Gesellschaften regelmäßig das Bedürfnis, in der Satzung zum Verhindern des Eindringens fremder Exekutionsgläubiger für den Fall der Gesellschafterinsolvenz ein Aufgriffsrechts der Gesellschaft oder eines ihrer Gesellschafter für diesen Fall vorzusehen, sowie zur Wahrung der Liquidität und somit letztendlich des Fortbestands der Gesellschaft die Höhe des Abfindungsanspruchs des ausscheidenden insolventen Gesellschafters der Höhe nach zu begrenzen.
Für die Gestaltungspraxis lassen sich dem Judikat sowohl positive als auch negative Auswirkungen entnehmen. Positiv ist dabei sicherlich zu bewerten, dass der OGH Beschränkungen der Abfindungshöhe grundsätzlich für zulässig erachtet, und es der Gesellschaft somit ermöglicht, im Falle einer satzungsmäßigen Abfindungsbeschränkung nicht stets den vollen Verkehrswert aufbringen zu müssen. Ebenso ist es erfreulich, dass endlich Rechtssicherheit dahingehend geschaffen wurde, dass das in der österreichischen Insolvenzordnung vorgesehene Verbot der Vereinbarung von insolvenzbedingten Lösungsklauseln (§§ 25a, 25b IO) keine Anwendung auf den Gesellschaftsvertrag findet, da dieser als mehrseitiger Vertrag nicht von den vorgenannten Bestimmungen erfasst wird, und dem Insolvenzverwalter des Gesellschafters auch kein einseitiges „Kündigungsrecht“ nach § 26 Abs. 3 IO in Bezug auf die dahingehenden Klauseln der Satzung zukommt.
Letztendlich wiegen die vorgenannten Vorteile unseres Erachtens jedoch nicht die erheblichen Nachteile auf, die sich aus der Entscheidung ergeben. Neben der Tatsache, dass nach wie vor in Bezug auf die mögliche Höhe des Abschlags auf den Abfindungsanspruchs mangels Entscheidungserheblichkeit keine klaren Aussagen getroffen wurden und somit diesbezüglich weiterhin Rechtsunsicherheit besteht, erweist sich die Lösung des OGH vor allem deswegen als völlig praxisuntauglich, weil die Rechtsprechung Beschränkungen in Abfindungsklauseln in Bezug auf die Gesellschafterinsolvenz dann, wenn sie nicht für sämtliche in der Satzung geregelten Aufgriffsrechte gleichermaßen gelten, als wegen Verstoßes gegen die guten Sitten nichtig ansieht (§ 879 ABGB). In der Praxis werden die scheinbaren Erleichterungen bei der Festlegung des Abfindungshöhe daher leerlaufen. Denn den Gesellschaftern wird so der Weg versperrt, für verschiedene Konstellationen sachgerecht zu differenzieren, und so z.B. wie in der Praxis üblich und auch regelmäßig gewünscht in Fällen des freihändigen Verkaufs des Geschäftsanteils oder einer Ausscheidens des Gesellschafters wegen eines von der Gesellschaft oder den anderen Gesellschaftern zu vertretenden wichtigen Grundes die Abfindung nach dem vollen Verkehrswert zu bemessen, bei einem in der Sphäre des ausscheidenden Gesellschafter liegenden wichtigen Grund (etwa Versterben, Pflichtverletzungen), von denen die Gesellschafterinsolvenz nur einen von vielen denkbaren Szenarien darstellt, jedoch interessensgerechte Abschläge zu vereinbaren.
Wer sich also für die Rechtsform einer österreichischen Kapitalgesellschaft entscheidet, steht vor dem Dilemma, entweder durch für alle Fälle vorgesehene Abfindungsbeschränkungen bei seinem Ausscheiden auch in un- oder gar fremdverschuldeten Fällen einen Teil des Werts seines Geschäftsanteils kompensationslos zu verlieren, oder aber durch einen für alle Fälle geltenden Verzicht auf solche Abfindungsbeschränkungen andere ausscheidende Gesellschafter auch dann voll abfinden zu müssen, wenn diese wiederholt gegen gesellschaftsvertragliche Pflichten verstoßen, versterben oder eben in die Insolvenz fallen.
Glücklicherweise lässt sich dieses Dilemma dadurch beheben, dass die Gesellschafter statt einer österreichischen Gesellschaft auf eine nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaats der EU verfasste Rechtsform zurückgreifen, oder aber eine bereits bestehende österreichische Kapitalgesellschaft in eine solche umwandeln können. Denn auch wenn die kollisionsrechtlichen Aspekte der Entscheidung bislang noch nicht Gegenstand von Gerichtsentscheidungen waren, sind satzungsmäßige Abfindungsbeschränkungen eindeutig gesellschaftsrechtlich zu qualifizieren, und unterliegen somit dem Recht, nach dem die jeweilige Gesellschaft verfasst ist. Dies folgt zum einen bereits daraus, dass die Wirksamkeit oder Nichtigkeit von Satzungsbestimmungen ausschließlich die zwischen den Gesellschaftern geltenden innergesellschaftlichen Rechte und Pflichten regeln, nicht jedoch Rechte und Pflichten sowie Verteilungsfragen anlässlich der Insolvenz eines dieser Gesellschafter.
Zudem wird die rein gesellschaftsrechtliche Qualifikation der Satzungsregelungen zum Abfindungsanspruch des Gesellschafters im Falle seines insolvenzbedingten Ausscheidens auch durch die vom OGH gewählte rechtliche Begründung unterstrichen, da dieser auf das allgemeine Verdikt der Sittenwidrigkeit rekurriert (§ 879 ABGB), nicht jedoch auf die spezifisch insolvenzrechtlichen Lösungsrechte aus § 26 Abs. 3 IO sowie deren Verbote in §§ 25a, 25b IO. Für diese könnte man zwar auf den ersten Blick wegen Art. 7 Abs. 2 lit e) EuInsVO eine insolvenzrechtliche Qualifikation erwägen. Dies scheitert jedoch bereits daran, dass auch diese kollisionsrechtliche Norm systematisch zutreffenderweise so auszulegen ist, dass sie nur schuldrechtliche Austauschverträge, nicht jedoch mehrseitige korporative Organisationsakte wie Satzungen betrifft. Zudem wäre eine Erstreckung der Norm auf satzungsmäßige Abfindungsbeschränkungen nicht mit dem Primärrecht vereinbar und die Norm somit primärrechtskonform auszulegen, da zumindest das korporative Innenrecht einer Gesellschaft nach der Rechtsprechung des EuGH nur dem Gründungsrecht der Gesellschaft untersteht.
Die vorliegende Abfindungsbeschränkung behandelt den Fall der Gesellschafterinsolvenz regelmäßig nur als einen unter vielen nicht insolvenzbezogenen Gründen für ein Aufgriffsrecht. Im Rahmen einer funktionalen Qualifikation gibt der Sonderfall der Gesellschafterinsolvenz der Satzungsklausel folglich kein spezifisch insolvenzrechtliches Gepräge, und anders als im vom EuGH entschiedenen Kornhaas-Fall oder im umstrittenen Fall der deutschen Existenzvernichtungshaftung betrifft das vom OGH statuierte strikte Gleichbehandlungsgebot auch keinerlei konkrete Handlungs- oder Verhaltenspflichten im Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren, so dass auch aus diesem Grund keine insolvenz- oder gar deliktische Qualifikation in Betracht kommt.
Eine differenzierte Satzungsgestaltung ermöglichen beispielsweise die deutsche GmbH oder die spanische SL, bei denen individuelle Differenzierungen je nach dem Grund des Ausscheidens möglich sind.
Florian Deck, 21.2.2021